Geschiebekunde aktuell 30 (4): 02-04, 1 Abb., Hamburg/Greifswald November 2014
ISSN 0178-1731
Ein
Warvitit aus einer Kiesgrube im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
A Warvitite from a Gravel Pit in Lippe, North Rhine-Westphalia
Tobias Langmann
Abstract.
This paper deals with the finding of a Warvitite in a gravel pit near
Müssen, Lippe District, North Rhine-Westphalia. The Geschiebe presented here
is a fossil warve clay with granitic dropstones and an eye-catching and
rather consistent foliation. A possible determination as a Hälleflint or an
Ignimbrite does not come into consideration as this rocktype’s fabric and
foliation conspicuously differs from the find’s ones. A dip into the
Kaerlein bibliography reveals that this Geschiebe obviously is the first
find of such a rock as a Geschiebe of nordic origin.
key
words: TK25 Bl.
4018 Lage, Tillite, Warvitite, Dropstone, Neoproterozoic Glaciation
Zusammenfassung. Im Folgenden wird der Geschiebefund eines Warvitites aus einer Kiesgrube in Müssen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Bei dem Geschiebe handelt es sich um einen stark verfestigten Warventon mit Dropstones. Der Blick in die Kaerlein-Bibliographie zeigt, dass dies der erste beschriebene Fund eines solchen Gesteines im nordischen Geschiebe ist. Eine Bestimmung als Metavulkanit (Hälleflint) oder als Ignimbrit kann aufgrund der Gesteinseigenschaften ausgeschlossen werden.
S c h l ü s s e l w ö r t e r: TK Bl. 4018 Lage, Tillit, Warvitit, Dropstone, neoproterozoische Vereisung
Einleitung
Aus Norwegen und Schweden sind Spuren von Vereisungen bekannt, die sich in
der erdgeschichtlichen Frühzeit des Präkambriums (Neoproterozoikum) ereignet
haben.
Neben geschrammten Felsoberflächen gehören hierzu Grundmoränen, die in
Ableitung des Wortes „Till“ wegen ihres stark verfestigten Zustandes als
Tillite bezeichnet werden. Bruchstücke der fossilen Tillite können als
pleistozäne Geschiebe auftreten. In das glaziäre Umfeld von Tills gehören
auch Warvite, also gebänderte feinkörnige Ablagerungen am Grund von
Eisstauseen.
Häufig sind in Warviten sogenannte „Dropstones“ enthalten, die aus der
Grundmoräne von Gletschern entstammen. In einer aus Gletschern
hervorgegangenen Eisscholle eingeschlossen treiben sie auf einen großen
Eisstausee oder das Meer hinaus. Wenn die Eisscholle abtaut, gibt sie ihre
Fracht frei, der Dropstone sinkt hinunter und fällt unter Bildung einer
Einschlagdelle in das feinkörnige Sediment am Gewässergrund. Dort wird er
nach und nach von nachfolgendem Sedimentmaterial überdeckt.
Warvite, verfestigt als Warvitite1
bezeichnet, scheinen seltener zu sein als
Tillite. Zwar sind aus Skandinavien einige Vorkommen von proterozoischen
Tilliten und Warvititen bekannt, doch liefert die geschiebekundliche
Literatur bisher keine Hinweise auf Funde von Warvititen im Geschiebe.
1 - In Fennoskandia sind alle präquartären Warvite in
Festgestein umgewandelt (Warvitit) und zusätzlich mehr oder weniger
metamorph überprägt (Metawarvitit) im Zusammenhang mit dem hohen Alter des
Grundgebirges.
Warvitit aus Müssen
Im Dezember 2011 fand
der Verfasser das im Folgenden beschriebene Geschiebe in einer Kiesgrube der
Fa. Ahle bei Müssen (Ortsteil von Lage) im Kreis Lippe, ca. 20 km
südwestlich von Bielefeld (etwa N 51°57.166‘, E 008°46.469‘).
Der Stein wurde auf einem Haufen von Geschieben unterschiedlicher
Größenklassen in einem stillgelegten Bereich des Kiesgrubengeländes
gefunden. Durch Nachfrage bei einem Angestellten der Kiesgrube wurde
bestätigt, dass das Material aus der Kiesgrube stammt.
Geschiebekundlicher Kenntnisstand des Fundgebietes
Das Fundgebiet liegt am Fuße des Teutoburger Waldes wenige Kilometer
nordwestlich der Grenze des saalezeitlichen Vereisungsgebietes und wurde
nach
Skupin et al.
(2003) wahrscheinlich nur einmal während des ersten hauptdrenthezeitlichen
Eisvorstoßes des Saale-Komplexes vom Inlandeis überfahren.
Die
Müssener Kiesgrube liegt in einem Bereich, in dem sich mit dem
Aue-Hunte-Gletscher und dem Porta-Gletscher zwei Teileisströme des
hauptdrenthezeitlichen Eisvorstoßes im Bereich zwischen Teutoburger Wald,
Wiehengebirge und Lipper Bergland mischten (Seraphim
1972). Die beiden Eisströme unterscheiden sich kaum im Hinblick auf das
Inventar nordischer Leitgeschiebe. Zählungen kristalliner Leitgeschiebe von
Zandstra (in
Skupin et al.,
2003) und
Lädige (1935) in
den Ablagerungen des Porta-Gletschers des Aue-Hunte-Gletschers zeigen
allesamt hohe Anteile småländischer Geschiebe von etwa 70 % (Dalarna <15 %,
Ostfennoskandien <10 %). Leitgeschiebe aus dem Oslogebiet konnten nur bei
Herford gefunden werden. Diese machten in der dortigen Zählung nur 2 % aller
berücksichtigten Leitgeschiebe aus (Lädige
1935).
Allerdings weisen
Skupin et al.
(1993) darauf hin, dass in Westfalen und somit auch im Fundgebiet Geschiebe
aus allen zehn Herkunftsgebieten Skandinaviens (vgl.
Zandstra 1983)
gefunden werden können.
Beschreibung des Gesteins
Das etwa 12×10×5 cm große Fundstück fiel durch seine auffällige Streifung
ins Auge. Man erkennt eine rhythmische Abfolge dunkler und heller Bänder,
die im oberen Teil des Geschiebes sehr regelmäßig und durchhaltend ist, in
der Mitte des Geschiebes aber gestört ist (s. Deckblatt). Darüber hinaus
sind zwei markant-rundliche granitische Xenolithe von drei und vier
Zentimeter Größe enthalten (Abb. 1). Diese unterbrechen die Bänderung nicht,
sondern haben sie lediglich derart nach unten verbogen, dass sich die Bänder
um die Xenolithe legen.

Die Körnung der Schichten ist sehr fein, es sind mit der Lupe keine
Einzelkörner oder Kristalle erkennbar. Ausnahme sind zahlreiche kleine,
rundliche Einschlüsse aus kristallinem Material im Größenbereich von wenigen
Millimetern. Diese Partikel stimmen petrographisch mit den großen Xenolithen
überein. Der Klastenbestand ist insgesamt als monomikt anzusehen.
R. Vinx
(pers. Mitteilung, 10.03.2013) weist nach Betrachtung des Fundstückes darauf
hin, dass Gestein bei geringfügiger interner Deformation schwach metamorph
überprägt ist, wobei die Metamorphose wohl nicht über die Grünschieferfazies
hinausgegangen ist.
Auffällig ist der hohe Verfestigungsgrad des vorliegenden Stückes, durch den
das Gestein einen massigen Eindruck macht. Eine bevorzugte Richtung der
Teilbarkeit liegt nicht vor, auch wenn eine Tendenz hin zu einer
schichtparallelen Teilbarkeit erkennbar ist.
Diskussion
Gesteinstyp
Die Lagenbildung des Gesteines und die Art der Einbettung der Xenolithe
weisen auf einen sedimentären Ursprung des Gesteins hin. Insbesondere das
Umschließen der Xenolithe lässt darauf schließen, dass diese in weiche,
plastische Sedimentlagen eingeschlagen sind.
Grundsätzlich kann bei dem hier beschriebenen Fundstück aber auch eine
Bestimmung als Hälleflinta, Aschetuff oder Ignimbrit in Erwägung gezogen
werden.
Die Hälleflinte sind nach
Vinx (2011)
einsprenglingsführende graue oder rötliche metamorph geprägte Vulkanite oder
Pyroklastite mit saurer, meist rhyolithischer Zusammensetzung. Manche
Hälleflinte zeigen eine „Foliation, die sich makroskopisch durch
Streifigkeit der Farbeverteilung, Einregelung von Einsprenglingen und auch
durch eine Hauptrichtung der Teilbarkeit zeigen kann.“ (Vinx
2011: 387). Die Bänderung des Fundstückes mag an die Foliation der
Hälleflinten erinnern. Allerdings weist
Smed (1994:91)
darauf hin, dass die Streifung bei Hälleflinten nicht den ganzen Stein
durchläuft, was aber bei dem Fundstück der Fall ist. Die Streifung des
Fundstückes ist für Hälleflinta untypisch gleichmäßig und vor allem im
ungestörten Teil (s. Abb. 1) oberhalb der Dropstones auffällig unturbidiert.
Zusätzlich zeichnen sich Hälleflinte ebenso wie Ignimbrite durch einen
splittrigen Bruch aus, der mit Bildung scharfkantiger und messerscharfer
Bruchstücke einhergeht (Vinx
2011). Dieses Bruchverhalten ist bei dem vorliegenden Geschiebe ebenfalls
nicht gegeben. Die Xenolithe lassen sich auch deshalb nicht als
Einsprenglinge in einem Hälleflint deuten, weil sie gänzlich undeformiert
sind. In Hälleflinten hingegen sind alle Bestandteile metamorph überprägt.
Dazu kommt, dass Hälleflinte mit solch großen Xenolithen aus dem Anstehenden
nicht bekannt sind. Auch für einen Aschentuff ist die Streifung zu
regelmäßig-rhythmisch und zu kleinmaßstäblich. Sie würde in dieser
Ausprägung ein „unrealistisch rhythmischen Fördermechanismus“ erfordern (R.
Vinx, pers.
Mitteilung,
10.03.2013).
Darüber hinaus fehlen die für Aschetuffe typischen vulkanogenen Klasten und
Zwischenkörnungen in der Matrix.
Eine Bestimmung als Ignimbrit mit eutaxitischem Gefüge kann insbesondere
durch das Bruchverhalten und die Art der Bänderung des Fundstückes
ausgeschlossen werden. Die Paralleltextur von Ignimbriten als Ergebnis der
Anwesenheit von Fiammen ist nicht so gleichmäßig wie die Bänderung des
vorliegenden Fundstückes. In den meisten Fällen durchläuft die Streifung von
Ignimbriten nicht den ganzen Stein (Smed
1994).
Die durchhaltende Bänderung aus abwechselnd hellen und dunklen Schichten ist
typisch für Warvite und Warvitite. Diese zeigen eine rhythmische
Wechsellagerung von hellen feinsand-siltigen und dunklen tonigen Lagen. Eine
helle und eine dunkle Schicht repräsentieren zusammengenommen jeweils ein
Jahr (Martin
2002). Diese Bänderung wird als das Resultat der jahreszeitlich bedingten
Schwankungen der Sedimentationsbedingungen interpretiert. So werden
Sommerlagen und Winterlagen gebildet, deren verschiedene Färbung auf
unterschiedliche Gehalte an organischem Material zurückzuführen ist. Während
die hellen Sommerlagen aufgrund der höheren Sedimentationsrate während der
Schnee- und Eisschmelze überwiegend aus anorganischem Material bestehen,
sind die Winterlagen wegen höherer Anteile organischen Materials dunkel
gefärbt (vgl.
Ehlers 2010:123).
Alle diese Eigenschaften zusammengenommen führen zur Bestimmung des
Fundstückes als diagenetisch verfestigter Warvit mit Dropstones.
Herkunft des Geschiebes
Bei einem seltenen Fund wie dem hier beschriebenen stellt sich die Frage
nach der Herkunft des Geschiebes. Aus Skandinavien sind zahlreiche Vorkommen
von neoproterozoischen Tilliten und Warvititen bekannt, wovon einige als
potentielle Liefergebiete in Frage kommen.
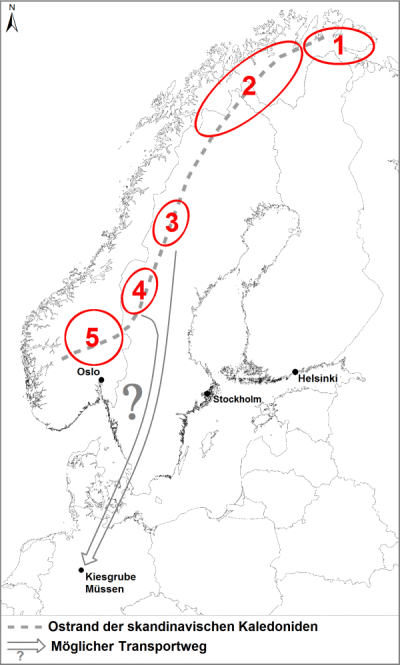 1. Norwegen
1. Norwegen
Aus Norwegen sind Vorkommen von neoproterozoischen Tilliten aus der Finnmark
im nördlichsten Norwegen und aus der südnorwegischen Sparagmitregion
bekannt.
Im Gebiet zwischen Varangerfjord und Laksefjord kommen mit der
Smalfjord-Formation und der Mortesnes-Formation (Abb. 2, Lok. 1) zwei
glazigene Formationen vor, die zwei getrennten Vereisungsereignissen
zuzuordnen sind (Edwards
&
Føyn, 1981). In
diesem Zusammenhang ist auch der bekannte und bereits von
Reusch (1891)
entdeckte Bigganjarga-Tillit am Ufer des Varangerfjords bei Karlebotn zu
nennen, welcher der Smalfjord-Formation zugerechnet wird. Bei der
Mortesnes-Formation handelt es sich um einen strukturlosen Tillit mit Lagen
aus laminiertem Tonstein mit Dropstones. Die Smalfjord-Formation besteht aus
unterschiedlich ausgeprägten Tilliten mit Lagen aus dropstoneführenden,
geschichteten Tonsteinen (vgl.
Edwards &
Føyn, 1981).
Darüber hinaus beschrieb
Holtedahl (1944)
Tillite am Duksfjord südostlich des Nordkaps.
Abb. 2: Vorkommen von Ablagerungen proterozoischer Vereisungen in Skandinavien (verändert nach Kulling (1951) und Arnaud et al. (2011):
1= Smalfjord- und Mortesnes-Formation in Finnmarken, 2= Nordwestskandinavischen Kaledoniden, 3= Zentralschwedischen Kaledoniden (Långmarkberg-Formation), 4= Südschwedischen Kaledoniden (Lillfjället-Formation), 5= Südnorwegische Sparagmitregion (Moelv- und Koppang-Formation)
Aus Südnorwegen ist der
bereits von
Holtedahl (1922)
entdeckte Moelv-Tillit (Moelv-Formation) bekannt (Abb. 2, Lok. 5). Dieser
kommt in der südnorwegischen Sparagmitregion auf einer Fläche von etwa
10.000 km² in stark variierender Mächtigkeit vor (Bjørlykke
&
Nystuen 1981;
Nystuen & Lamminen 2011).
Innerhalb der Moelv-Formation lassen sich zwei Fazies unterscheiden: Ein
massiger Tillit, der als Grundmoräne abgelagert wurde, und im oberen Bereich
ein laminierter Tonstein mit eingestreuten Klasten als „glaziomarine
Sedimente aus treibenden Eisbergen“ (Bjørlykke
und
Nystuen 1981).
Die Moelv-Formation hat mit Tilliten im Engerdalen-Becken (Koppang-Formation)
im Norden der Sparagmit-Region ein Äquivalent (Nystuen
&
Lamminen 2011).
2. Schweden
Aus Schweden sind zahlreiche Vorkommen von neoproterozoischen Tilliten und
Warvenschiefern in den Kaledoniden bzw. entlang der Kaledonischen Front
bekannt.
Im Bereich der nordwestskandinavischen Kaledoniden (Abb. 2, Lok. 2)
beschrieb Kulling (1951) unter dem Begriff „Sito-Tillit“ ein Tillitvorkommen
in Norbotten im Gebiet um den See Sitojaure. Seit Kullings Untersuchungen
sind zahlreiche weitere Vorkommen von teils glazigenen Diamiktiten in
zahlreichen isolierten Aufschlüssen in einem etwa 500 km langen Bogens
zwischen Porsangerfjord im Nordosten dem See Sitojaure im Südwesten bekannt
geworden. Der glazigene Charakter ist dabei allerdings nicht immer klar (Stodt
et. al 2011). Diese Vorkommen sind mit gebänderten, warvenartigen
Siltsteinen („varve banded siltstone)“ verknüpft (Kulling 1948, Kulling
1938, Stodt et al. 2011).
Weiter südlich finden wir in den zentralschwedischen Kaledoniden auf einer
160 km langen Linie nördlich von Östersund bei einer maximalen Breite von 20
km die Långmarkberg-Formation (Abb. 2, Lok. 3) (Thelander 1981).
Sie zeichnet sich durch das großräumige Vorkommen von tillitartigen
Schichten mit gekritzten Geschieben und ebenmäßig laminierten Siltsteinen
mit eingestreuten Xenolithen (Klasten, Dropstones) aus (Thelander 1981).
Magnusson et al. (1963:185) bilden ein Handstück eines „Warvenschiefers“ vom
Långmarkberg im nördlichen Jämtland ab. Dieses Stück kommt dem hier
beschriebenen Fund in petrographischer Hinsicht sehr nahe. Darüber hinaus
kommen in Jämtland, im westlichen Mittelschweden, glazigene Diamiktite mit
assoziierten, teils sandige und laminierten Tonsteinen mit Dropstones.
Diese von Kumpulainen (1980, 1981) als „Lillfjället-Formation“ bezeichnete
glazigene Formation aus dem Neoproterozoikum wurde in Jämtland in einem
engen Gürtel bei einer N-S-Ausdehnung von etwa 70 km und einer Breite von
wenigen Kilometern in einigen isolierten Aufschlüssen nachgewiesen (Kumpulainen
& Nystuen 1985, s. Abb. 1, Lok. 4).
Alle diese hier beschriebenen Vereisungsspuren fügen sich in eine Reihe
weiträumiger Vereisungen, die sich im Neoproterozoikum ereigneten und zur
Entwicklung der bekannten „Snowball Earth“-Theorie führten.
Als weiterführende Literatur über diese Vereisungen und ihre Ablagerungen in
Skandinavien und weltweit sei Arnaud et al. (2011) empfohlen.
Doch welche dieser Vorkommen kommen als Liefergebiet für den hier
beschriebenen Warvitit in Frage?
Aufgrund der Zusammensetzung des Geschiebes im Fundgebiet erscheint eine
Herkunft des Fundstückes aus einem der zahlreichen Vorkommen am Ostrand der
schwedischen Kaledoniden wahrscheinlich. Dabei kommen neben den oben
beschrieben südlicheren Vorkommen auch die weiter nördlich gelegenen
Vorkommen bis hin zu den Tilliten der Långmarkberg-Formation als
Herkunftsgebiet in Frage, zumal im norddeutschen Geschiebe schon Geschiebe
aus diesem Gebiet gefunden wurden. So bildet
Bräunlich auf
www.kristallin.de ein von H. Nipperus gefundenes Geschiebe des
Sorsele-Granites aus Damsdorf ab. Eine Herkunft aus den südnorwegischen
Vorkommen ist aus demselben Grund sehr unwahrscheinlich, wenn auch nicht
ausgeschlossen. Zwar ist die Nordgrenze des Geschiebeeinzugsgebietes
unbekannt, doch kann eine Herkunft aus den Vorkommen in der norwegischen
Finnmark und den nördlichen skandinavischen Kaledoniden als sehr
unwahrscheinlich angesehen werden. Aufgrund des hohen Verfestigungsgrades
des Fundstückes ist anzunehmen, dass das Alter des Gesteins im Bereich von
vielen 100 Millionen Jahren liegt und das Geschiebe somit ein seltenes
Zeugnis einer Eiszeit der Erdfrühzeit ist. Genaueres kann hierbei allerdings
nur durch eine Datierung festgestellt werden.
Ergebnis
Die Abwägung verschiedener Argumente ergibt, dass das Geschiebe von Müssen
als schwach metamorph überprägter Warvit gedeutet werden muss. Seine
Herkunft kann nicht genau festgelegt werden, wenn gleich die proterozoischen
Tillit-Vorkommen mit begleitenden Warvititen entlang des mittel- und
nordschwedischen Kaledoniden als wahrscheinlichstes Liefergebiet angesehen
werden können. Auskunft über Alter und eine Zuordnung zu den verschiedenen
Grundgebirgseinheiten ist nur nach einer Altersbestimmung durch eine
radiometrische Datiererung möglich. Andere Untersuchungsmethoden sind sind
nach heutigem Kenntnisstand nicht erkenntnisversprechend.
Dank: Prof. Dr. Roland Vinx, Elmshorn, danke ich für seine ausführliche Stellungnahme, Werner A. Bartholomäus, Hannover, für die Mitarbeit am Manuskript und Matthias Bräunlich, Hamburg, für die Unterstützung und die Bilder des Fundstückes.
Schriften
Arnaud, E., Halverson, G. P. & Shields-Zhou, G. (eds) 2011 The Geological Record of Neoproterozoic Glaciations. Geological Society, London, Memoirs, 36. 735 S.
Bjørlykke K & Nystuen J P 1981 Late Precambrian tillites of South Norway. In: Hambrey, M. J. & Harland, W. B. (eds) Earth’s Pre-Pleistocene Glacial Record. Cambridge University Press, Cambridge, 624–628
Bräunlich M, Sorsele-Granit aus Nordschweden, unter http://www.kristallin.de/Schweden/
Sorsele/Sorsele-Granit.htm, abgerufen am 03.09.2014
Edwards MB & Føyn S 1981 Late Precambrian tillites in Finnmark, North Norway. In: Hambrey, M. J. & Harland, W. B. (eds) Earth’s Pre-Pleistocene Glacial Record. Cambridge University Press, Cambridge, 606–610.
Ehlers J 2011 Das Eiszeitalter - Spektrum Sachbuch: IX+363 S., 347 meist kapitelweise num. Abb. (davon 327 farbig), 12 kapitelweise num. Tab., 32 Kästen, Heidelberg etc. (Spektrum Akademischer Verlag in Springer SBM).
Holtedahl O 1922 A tillite-like Conglomerate in the "Eocambrian" sparagmite of southern Norway - American Journal of Science (Ser. 5) 4 (August): 165-173, New Haven, CT.
Holtedahl O 1944 On the Caledonides of Norway, with some scattered local observations, Det norske Vidensk. Akad, Skrifter Oslo, I. Mat. Naturv. Kl., Nr. 4, 31 S., Oslo
Kulling O 1938 Notes on varved boulder-bearing mudstone in eocambrian glacials in the mountains of Northern Sweden. - Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 60 (8): 392-396, Stockholm
Kulling O 1942 Grunddragen av fjällkedjerandens bergbyggnad inom Västerbottenslän. Sveriges geologiska undersökning C, 445, 320.
Kulling O 1948. Om berggrunden i Sareks randområden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 70, 661–672.
Kulling O 1951 Spår av Varangeristiden i Norrbotten. Eokambriska varvskiffrar och tilliter i Norbottensfjällens östra rand i nordligaste Sverige - Sveriges Geologiska Undersökning C 503 [Årsbok 43 (1)]: 44 S., 30 Abb., Stockholm.
Kumpulainen R 1980 The Upper Precambrian stratigraphy and depositional environments of the Tossåsfjället Group, Särv Nappe, southern Swedish Caledonides. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 102, 531–550.
Kumpulainen R 1981 The Late Precambrian Lillfjället Formation in the southern Swedish Caledonides. In: Hambrey, M. J. & Harland, W. B. (eds) Earth’s Pre-Pleistocene Glacial Record.
Cambridge University Press, Cambridge, 620–623.
Kumpulainen R & Nystuen J P 1985 Late Proterozoic basin evolution and sedimentation
in the westernmost part of Baltoscandia, in: Gee, D.G., and Sturt, B.A., eds, The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas: Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 213–232.
Lädige R 1935 Die kristallinen Geschiebe im Gebiet des Meßtischblattes Herford-Ost. - Zeitschrift für Geschiebeforschung 11 (1): 42-49, 2 Abb., Leipzig.
Martin C 2000-2002 (Hrsg.) Lexikon der Geowissenschaften - 5 Bände + Band 6 (Register), ca. 450 S. pro Bd., ca. 2500 Abb., Heidelberg etc. (Elsevier / Spektrum Akademischer Verl.)
Magnusson NH, Lundqvist G & Regnéll G 1963 Sveriges geologi 4. Aufl. - 698 S., zahlr. Abb., 3 Ktn., Stockholm (Norstedts Svenska Bokförlaget).
Nystuen, J. P. & Lamminen, J. T. 2011. Neoproterozoic glaciation of South Norway: from continental interior to rift and pericratonic basins in western Baltica. In: Arnaud, E., Halverson, G. P. & Shields-Zhou, G. (eds) The Geological Record of Neoproterozoic Glaciations. Geological Society, London, Memoirs, 36, 613–622.
Reusch H 1891 Skuringmærker og morængrus eftervist i Finnmarken fra en periode meget ældre end ‘istiden’ (Glacial striae and boulder-clay in Norwegian Lapponie from a period much older than the last ice age) - Norges Geologiske Undersøkelse 1: 78-85, 97-100, Kristiania.
Seraphim ET 1972 Wege und Halte des saalezeitlichen Inlandeises zwischen Osning und Weser - Geologisches Jahrbuch A 3: 1-85, 14 Abb., 6 Tab., Hannover.
Smed P 1994 Steine aus dem Norden Geschiebe als Zeugen der Eiszeit in Norddeutschland - Deutsche Übersetzung und Bearbeitung durch J. Ehlers - (I+) 195 S., 34 Taf., (1+) 83 Abb., 1 Kte., Berlin / Stuttgart (Borntraeger).
Skupin K, Speetzen E & Zandstra JG 2003 Die Eiszeit in Nordrhein-Westfalen und angrenzender Gebieten Niedersachsens ; Elster- und saalezeitliche Ablagerungen und ihre kristallinen Leitgeschiebegemeinschaften - 95 S., 15 Abb., 10 Tab., 3 Anh., Krefeld (Geol. Landesamt Nordrhein-Westfalen).
Stodt F, Rice AHN., Björklund L, Bax G & Pharaoh TC 2011 Evidence of late Neoprotero-zoic glaciation in the Caledonides of NW Scandinavia. In: Arnaud, E., Halverson, G. P. & Shields- Zhou, G. (eds) The Geological Record of Neoproterozoic Glaciations. Geological Society, London, Memoirs, 36, 603–611.
Thelander T 1981 The late Precambrian Långmarkberg Formation, central Swedish Caledonides. In: Hambrey, M. J. & Harland, W. B. (eds) Earth’s Pre-Pleistocene Glacial Record. Cambridge University Press, Cambridge, 615–619.
Vinx R 2011 Gesteinsbestimmung im Gelände - 3. Aufl., XI+480 S., 418 Abb., 14 Tab., Heidelberg etc. (Spektrum).
Zandstra JG 1983 A new subdivision of crystalline fennoscandian erratic pebble assemblages (Saalian) in the Central Netherlands, Geol. Mijnb. 62: 455-469, ‘s Gravenhage