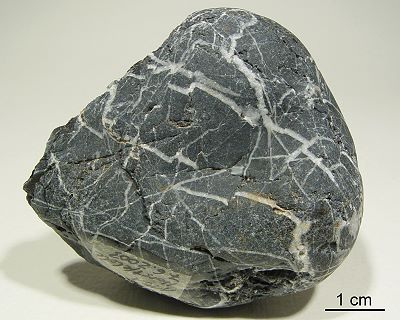Dies ist die Druckansicht.
Zur Normalansicht
Lydit / Radiolarit
/ Kieselschiefer:
Diese drei Begriffe bezeichnen das
gleiche Gestein, wobei die Bezeichnung
"Lydit" häufig für paläozoische Formen und "Radiolarit" für die
mesozoischen Gesteine der Alpen verwendet wird.
Der sinnvolle Oberbegriff für dieses Gestein unabhängig vom Alter ist
"Radiolarit".
Es handelt sich um ein marines Sedimentgestein, das in der Tiefsee entsteht und
aus den kieseligen (SiO2) Resten einzelliger
Strahlentierchen – den Radiolarien – aufgebaut ist . Diese sinken zu nach ihrem
Ableben im Meer in die Tiefsee und bilden unter günstigen Bedingungen (vor allem
geringe oder fehlende sonstige Einträge von Sand, Ton etc.) den
Radiolarienschlamm. Dieser Schlamm ist für sein extrem langsames Anwachsen
bekannt: Sedimentationsraten von wenigen Millimetern pro tausend Jahre scheinen
üblich zu sein.
Aus diesem Radiolarienschlamm bildet sich durch Diagenese der Radiolarit.
Seinen Weg an Land und in die Handstücke findet das Gestein im Zuge von
Subduktion und Gebirgsbildung. Dabei kommt es zur Entwässerung, Verdichtung und
Kompaktierung. Die feinen Sedimentlagen bleiben nur manchmal erhalten und sind
selten im Handstück zu sehen. In der Regel sind die als Lydit (oder
Kieselschiefer) bezeichnet Stücke durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:
-
Extrem hartes, splittrig oder
muschelig brechendes Gestein, das immer nur in kleinen Dimensionen gefunden
wird. Fundstücke erreichen selten mehr als einen Dezimeter, meist bleiben sie
unter Faustgröße.
-
Meist tiefschwarz oder grau
(paläozoisch), aber auch grünlich bis rot (mesozoische Radiolarite der Alpen).
Feinstkörniges bis dichtes Gefüge, keine Fossilien über Radiolariengröße. Auch
letztere sind nur in Ausnahmefällen erkennbar und unter einem Millimeter
klein.
-
Oft ist das Gestein stark gefaltet
und von vielen Brüchen durchzogen, die regelmäßig mit Quarzäderchen gefüllt
sind.
-
Radiolarite sind so hart, daß sie
oft eine deutlich geringere Rundung als das Umgebungssediment aufweisen. Der
splittrige, kantige Bruch bleibt lange erkennbar.
Die schwarzen
Radiolarite/Lydite, die in Deutschland gefunden werden, sind sichere Indikatoren
für eine südliche Herkunft. Sie stammen aus dem Harz, dem Thüringer Wald oder
dem Erzgebirge/Böhmen und benachbarten Gebieten. In Skandinavien fehlen
Radiolarite/Lydite fast vollständig. Ich habe noch nie einen im nordischen
Geschiebe gefunden, wohl aber Mengen davon, sobald man in die Bereiche der
Flußschotter unserer nach Norden bzw. Westen entwässernden Flüsse kommt.
Es soll kleine Vorkommen von Lydit im Norden geben, aber die können für die
Bestimmung im Gelände ignoriert werden.
(Zur Bestimmung lesen Sie bitte ganz unten die Anmerkung)
Lydite sind daher gut geeignet, Fehlbestimmungen zu vermeiden und den Sammler zu
warnen. Im Winter 2005/2006 fand sich in der Kiesgrube Vastorf bei Lüneburg
(Niedersachsen) neben Mengen an nordischen Geschieben etwas abseits ein
Kieshaufen. Er enthielt ungewöhnliche Porphyre und etliche Lydite. Diese gaben
den Ausschlag für die Annahme, daß es sich bei diesem Kieshaufen um einen
Fremdgesteins"import“ in die Kiesgrube handeln mußte. In skandinavischem
Geschiebe kommen niemals Lydite plus Zellenquarze vor. Damit war auch klar, daß
die begleitenden Porphyre südlicher Herkunft sein mußten.
Es folgen einige Fotos von Lyditen, die alle durch nordwärts fließendes Wasser
an ihre Fundstellen in Brandenburg bzw. Thüringen gelangten.
Dieses südliche Geröll stammt aus
Brandenburg (Horstfelde) aus einem nicht mehr vorhandenem Elbelauf.
Die zerscherten Quarzgänge sind typisch für Lydite.
Sammlung Jan Kottner
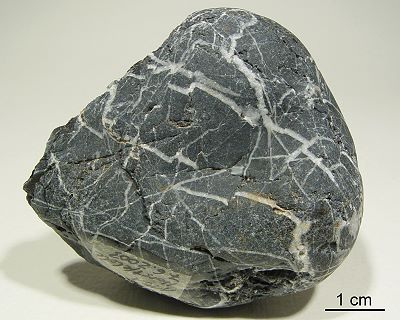

Die folgenden drei Lydite stammen aus einer Kiesgrube in Untschen bei Schmölln
in Thüringen.
Der erste zeigt die typische Quarzdurchäderung.


Dieser hier unterhalb ist tektonisch nur mäßig beansprucht.
Die Sedimentschichtung ist erkennbar


Der dritte hat eine für Lydite recht beachtliche Größe. Auch hier ist der Quarz
nachträglich gefaltet worden (untere Bildhälfte)


Das letzte Bild zeigt einen Lydit aus dem Anstehenden.
Die Probe stammt aus Langenstriegis bei Chemnitz, S. Adolph legit.
Sammlung Kottner


Der Begriff „Kieselschiefer“ ist
falsch und sollte vermieden werden.
Das Gestein ist nicht geschiefert und bricht nicht dünnplattig -
was ja gerade einen Schiefer auszeichnet.
Anmerkung zur Bestimmung dieses Gesteins:
Wenn man ein einzelnes, isoliertes Gestein im Gelände findet, das den hier
abgebildeten ähnelt, so liefert der Vergleich mit den Fotos allein keine
verläßliche Bestimmung. Streng genommen sind Gesteine mit einem dichten Gefüge
wie Lydite „von Hand“ überhaupt nicht sicher bestimmbar, da oft auch mit der
Lupe keinerlei Details erkennbar sind. Die Quarzgängchen sind zwar oft in
Lyditen enthalten, sind aber nicht zwingend erforderlich.
Man kann also immer nur die mehr oder weniger gut begründete Vermutung äußern,
daß ein Gestein wahrscheinlich ein Lydit sei. Dabei kommt es entscheidend auf
die Begleitumstände an.
Südliche Gerölle bilden immer Gemeinschaften von typischen Gesteinen. Dazu
gehören für die Herkunftsgebiete Erzgebirge/Lausitz/Böhmen insbesondere die
Kasten- (bzw. Zellen) -quarze, streifig durchscheinende Quarze, gelbliche und
rötliche Quarze, Achate und weitere, für die stromaufwärts gelegenen Gebiete
typische Gesteine. Erst das gleichzeitige Auftreten solcher geographisch
verwandter Gesteine ist ein Hinweis, daß schwarze, feinstkörnig-dichte Gesteine
mit auffälliger Härte sehr wahrscheinlich Lydite sind. Wie gesagt: das ist dann
eine gut begründete Vermutung.
Eine wirklich verläßliche Gesteinsbestimmung erfordert immer die sichere
Identifizierung der beteiligten Minerale und eine Untersuchung des Gefüges.
Das ist bei feinkörnigen Gesteinen wie diesem hier grundsätzlich nur im Labor zu
leisten.