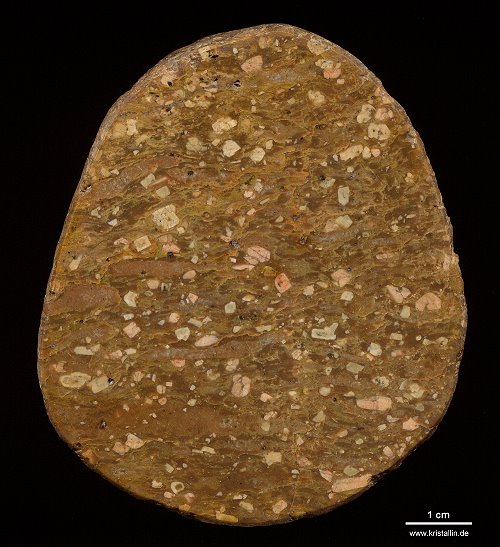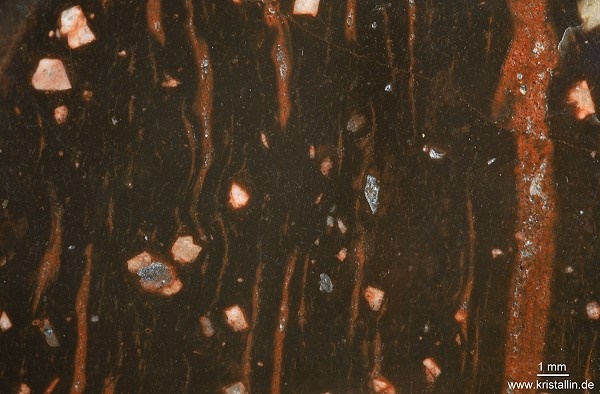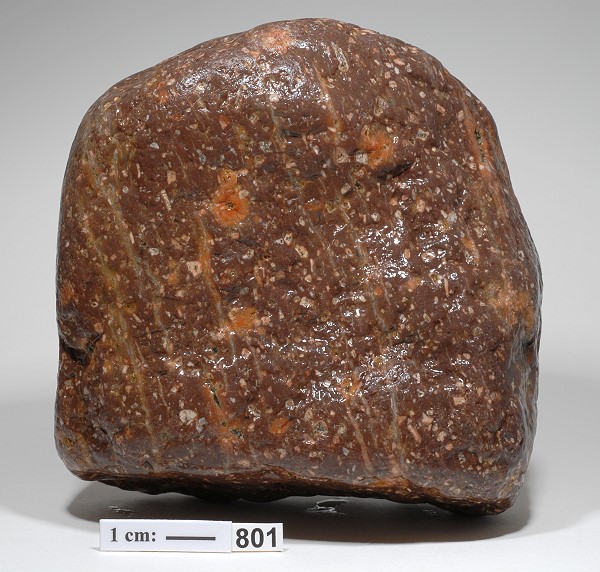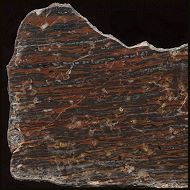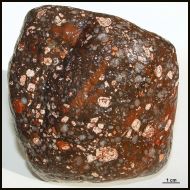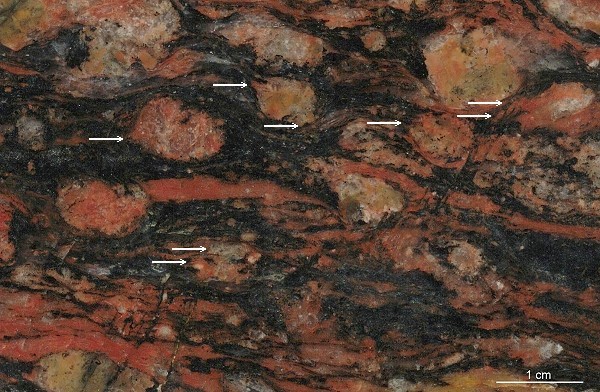Auch der folgende Ignimbrit stammt aus dem Geschiebe.
Er zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Färbung aus. Gefunden am Brodtener
Ufer, Ostsee.
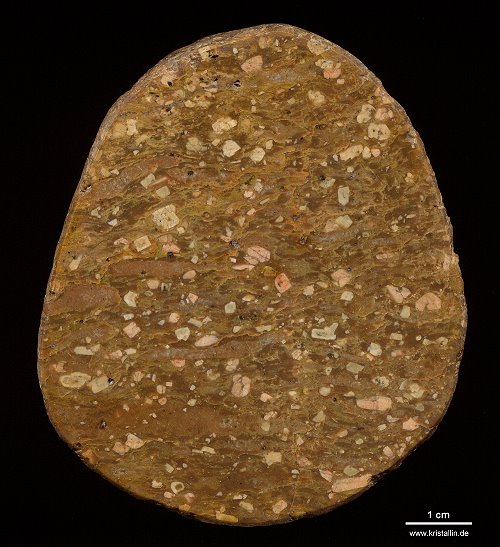

In diesen Eutaxit sind viele gelbliche und einige schwach rosafarbene Feldspäte
eingestreut.
Auch die Flammen zeigen einen gelbbraunen Farbton. Gesteinsbruchstücke (Xenolithe)
sind
nicht enthalten. Dieses Gestein ist, soweit ich weiß, in der Literatur
nicht beschrieben und seine Herkunft
ist unklar. Es scheint überdies sehr selten
zu sein. Wenn Sie ein solches Geschiebe finden sollten, würde ich mich
über eine Nachricht freuen. Vielleicht hilft der Fundort, das Herkunftsgebiet
einzugrenzen.
Eutaxitische Gefüge wie die bisher gezeigten gibt es nicht nur in harten
Gesteinen.
Der nächste Ignimbrit ist nicht im
entferntesten so fest wie die
Porphyre aus Dalarna.
Rochlitzer Porphyr aus Sachsen:


Dieses Gestein stammt aus dem Perm, ist also noch recht jung. Es baut den Rochlitzer Berg auf,
der nördlich von Chemnitz in Sachsen liegt. Der Stein wird abgebaut und
liefert einen lebhaft gezeichneten Werkstein. Das Gestein ist im bergfrischen
Zustand gut zu bearbeiten und hat nur eine mittlere Härte.
Rochlitzer Porphyr wurde nicht nur in Sachsen und Thüringen in großer
Menge verbaut, sondern findet sich sogar in Hamburg. Dieses attraktive
Gestein hätte auch heute noch durchaus mehr Wertschätzung verdient.
Die Poren zeigen an, daß das noch heiße
Gestein direkt nach der Ablagerung weiter entgaste.
Die aus einer Lava entweichenden Gase („Volatile“) sind hauptsächlich
Kohlendioxid und Wasser.
In rhyolithischen Magmen wie diesem hier überwiegt meist
der Wassergehalt den des Kohlendioxids.
Solche Lava kann
bis zu 7 Gewichtsprozent Wasser enthalten. Das ist
sehr viel.
Dieses überhitze Wasser und das Kohlendioxid sind es, die den Vulkan
antreiben und einen Großteil der Energie für den Ausbruch liefern.
Das nächste Bild zeigt wieder ein Gestein aus dem Norden. Es handelt sich
um einen "Älvdalen-Porphyr" aus Mittelschweden.
Unter diesem Namen werden Ignimbrite aus Dalarna zusammengefaßt, die vor
etwa 1700 Millionen Jahren entstanden. Viele von ihnen zeigen
perfekte eutaxitische Gefüge.


Typischer Ignimbrit aus Dalarna. Nahgeschiebe in Mittelschweden.
Ignimbrite mit eutaxitischem Gefüge zeigen zwar immer gleiche Merkmale,
nämlich eine dichte Grundmasse mit Einsprenglingen und um diese herum
abgelagerte Bimsfladen, aber das Aussehen der Gesteine schwankt in
weiten Grenzen.
Man findet im Geschiebe zierliche, sehr filigran gezeichnete Ignimbrite und
auch solche mit sehr
grob strukturierten Gefügen.
Unten:
Ignimbrit aus der Nähe von Älvdalen/Dalarna. Im Stück polierter
"Handschmeichler".
 
Dieser Stein ist gerade mal 4 cm breit, aber sein Ignimbritcharakter ist
trotzdem deutlich.
Der Ausschnitt unten zeigt mehr.
Alle Feldspateinsprenglinge sind kleiner als 1 mm, die meisten der Flammen
sind hauchdünn,
die kräftige am rechten Bildrand erreicht gerade einen Millimeter.
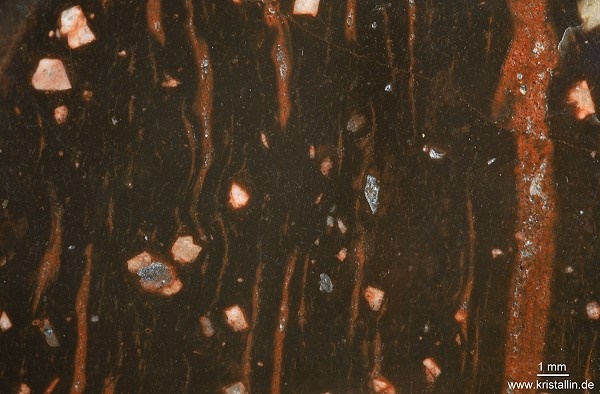

Das nächste Beispiel dagegen zeigt dagegen ein üppig groß ausgebildetes
Gefüge.
Ignimbritgeschiebe von Heiligenhafen, Ostsee:


Dieses Geschiebe wird von einer mehr als fingerdicken Schliere (Fiamme)
durchzogen, die im ursprünglichen Gesteinsverband gut und gern 40 cm lang
gewesen sein mag. Das Gestein kommt sehr wahrscheinlich ebenfalls aus
Dalarna in Schweden.
Ignimbrite mit solch dicken Flammen sind im Geschiebe selten.
In den glazialen Ablagerungen sind eutaxitische Ignimbrite zwar
nicht häufig, werden
aber immer wieder gefunden.
Die meisten dieser schön gezeichneten Gesteine kommen aus Dalarna.
Sie sind gute
Leitgeschiebe für das Vulkanitgebiet nordwestlich vom Siljansee.
Hier noch ein weiteres Beispiel:
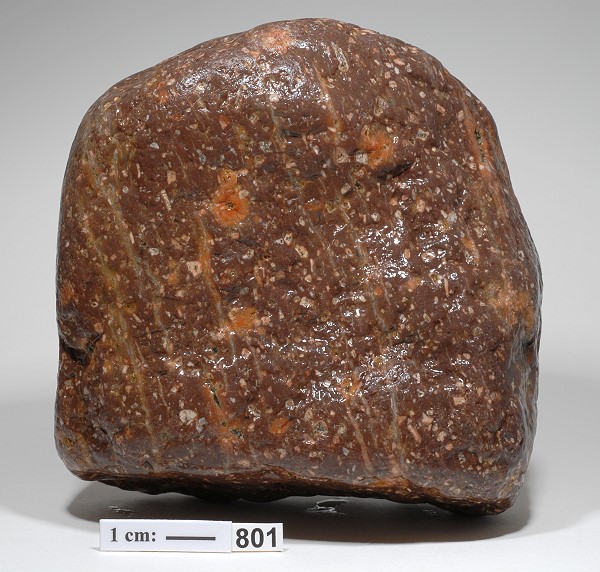

Ignimbrit aus Dalarna. Geschiebe von Glowe auf Rügen.
Auf diesen Vulkaniten basierte übrigens im Schweden des 19. Jahrhunderts
 eine beeindruckende
Steinverarbeitung.
Siehe Bild rechts. eine beeindruckende
Steinverarbeitung.
Siehe Bild rechts.
Mehr dazu finden Sie bei der
Beschreibung des
Blyberg-Porphyrs.
Anmerkung zu "Porphyr": Porphyre können durchaus Ignimbrite sein. Um ein
Porphyr zu sein, genügt es, wenn Einsprenglinge in einer feinkörniger
Grundmasse stecken. Sofern die hier gezeigten Ignimbrite solche Gefüge
haben, sind sie auch Porphyre. Der Umkehrschluß ("Dieser Porphyr ist ein
Ignimbrit") gilt bei der Bestimmung von Hand nur, wenn man zusätzlich
Flammen findet, also ein eutaxitisches Gefüge vorliegt.
In
der älteren Literatur wurden solche Gesteine übrigens auch als „schlierige
Porphyre“ bezeichnet. Diese Beschreibung trifft das
Äußere recht gut.
Eutaxite aus anderen Vorkommen:
Neben den Ignimbriten aus Dalarna gibt es in Schweden auch weiter südlich, in Småland, einige wenige Ignimbrite, die
ein schönes eutaxitisches Gefüge zeigen.
Diese sind im Geschiebe allerdings recht selten.
Neben denen aus Småland findet man im Geschiebe noch den Ignimbrit
von Åland und einzelne rote Ostsee-Quarzporphyre, die ein
perfektes, eutaxitisches Gefüge haben.
Ein Beispiel für alle drei finden Sie hier unterhalb.
|
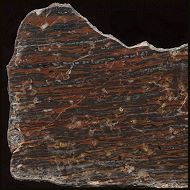
Ignimbrit von
Idekulla (Småland) |
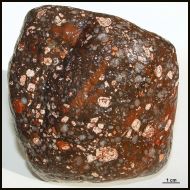
Aland-Ignimbrit |

Roter
Ostsee-Quarzporphyr |
Auch bei den norwegischen Ignimbriten aus dem Oslograben kommen Eutaxite
vor.
Im Südosten Deutschlands kann man
an einigen Stellen die skandinavischen und die sächsischen Ignimbrite
nebeneinander finden. Permische Ignimbrite aus Sachsen werden mit den Flüssen nach Norden
transportiert, die nordischen Geschiebe wurden vom Eis aus Schweden bis an
den Rand des Erzgebirges verschleppt: Jung (Sachsen) trifft alt
(Schweden).
Fehlbestimmungen im Geschiebe:
Geschiebesammler sind oft von dem Wunsch erfüllt, bestimmte, möglichst
hübsche oder seltene Leitgeschiebe zu finden. In diesem Streben wird
gelegentlich übers Ziel hinausgeschossen.
Es erfordert aber genaues Hinsehen,
wenn man sich bei einem Gestein auf die Bezeichnung "Ignimbrit" festlegt. Es genügt nicht, daß das
Gestein streifig aussieht, Feldspateinsprenglinge hat und die Farbe
stimmt.
Es gibt durchaus Möglichkeiten, einen Ignimbrit mit einem ähnlichen
Gestein zu verwechseln.
Das trifft zum Beispiel auf Gneise zu. Insbesondere die Grundmasse um die Einsprenglinge
herum sowie die Streifen im
Gestein
sollte man genau kontrollieren. Schauen Sie kritisch nach, ob die Bruchstücke und die Grundmasse
wirklich abgelagert aussehen oder ob es Hinweise gibt, daß das
Gefüge durch eine seitliche Scherbewegung deformiert wurde.
In einem Ignimbrit schmiegt sich die Grundmasse an die Einsprenglinge oder
Gesteinsbruchstücke an. Die Form der Einsprenglinge wird nicht von der
Grundmasse beeinflußt, denn die Kristalle oder Bruchstücke sind bereits vor dem Ausbruch in der Lava vorhanden. Sie sind
Festkörper, die im Ignimbrit von den Bimsfladen und der vulkanischen Asche
eingehüllt und umflossen werden.
In Gneisen wie dem folgenden dagegen sind die
Einsprenglinge verformt, sei zeigen eine seitliche Ausschwänzung.
An den Enden der Einsprenglinge zeigen sich kleine, tropfenförmige Zipfel.
Diese sind das Ergebnis einer Scherbelastung, die den
gesamten Gneis formte.
Das Gestein zeigt eine
gleichzeitige Verformung von Grundmasse und Einsprenglingen.
Gneis ("Loftahammar Gneisgranit")
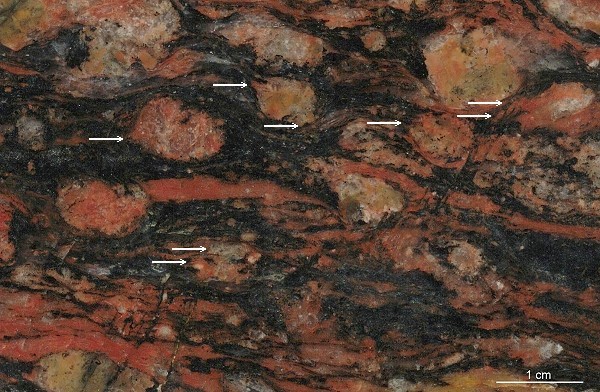

Die Pfeile zeigen auf die kritischen Stellen.
Nur wenn die Einsprenglinge undeformiert sind und das Material um sie
herum wirklich abgelagert aussieht, handelt es sich um einen Ignimbrit.
Dazu bedarf es immer der Kontrolle mit einer Lupe.
Auch feinkörnige Vulkanite können deformiert sein und dann einem Eutaxit sehr
ähnlich sehen.


Das Bild zeigt die polierte Schnittfläche eines Geschiebes, das auf den
ersten Blick nach einem Ignimbrit aussieht.
Schaut man genau hin, zeigt sich jedoch, daß die Einsprenglinge (hier sind
es Quarze) verformt sind.


Auch dieses Gefüge weist Deformationen auf. Sie sind klein, aber deutlich. Wenn
Sie die Vergrößerung anschauen, sind die seitlichen Verformungen der
Quarze gut zu erkennen.
Dieses Gestein könnte ursprünglich ein Ignimbrit gewesen
sein, aber das wäre nur durch eine weitergehende Untersuchung
zu klären. In jedem Falle wurde das Gestein nachträglich verformt, so daß
nur von diesem Anblick her die Bezeichnung Ignimbrit nicht
gerechtfertigt ist.
Ein anderer Hinweis auf eine stattgefundene Metamorphose sind Streifen im
Gestein, die lang und gerade sind. Flammen, die ihre Wellung verloren
haben und gleichmäßig dünn und auffallend lang sind, gehören nicht in ein
eutaxitisches Gefüge. In einem normalen Ignimbrit sind die Streifen nicht gerade,
sondern leicht gebogen, gewellt und an den Enden ausgefranst.
Gesteine wie der hellbraune Vulkanit hier oberhalb können einmal durchaus Ignimbrite gewesen sein. Allerdings führt
eine Metamorphose zur zunehmenden Verwischung der typischen Merkmale.
Der ursprüngliche Ignimbrit geht dann nach und nach in einen metamorphen
Vulkanit über.
Solche graduellen Veränderungen sind für einen Laien kaum sicher zu
erkennen, da man in der Regel keine Dünnschliffe anfertigt.
Daher sollte man sich bei der
Benennung "Ignimbrit" auf die wirklich eindeutigen und sicheren
Fälle beschränken.
Wenn Sie zu keinem klaren Ergebnis kommen, belassen Sie es
bei "Porphyr" oder "Rhyolith".
Damit sind Sie auf der sicheren Seite.
Mit der Benennung „Ignimbrit“ dagegen machen Sie eine sehr präzise Aussage über eine
spezielle, vulkanische Entstehung.
Die Beschreibungen der im Text angesprochenen Ignimbrite finden Sie hier:
Åland-Ignimbrit
Älvdalen-Porphyre
Blyberg-Porphyr
Roter Ostsee-Quarzporphyr
Småland-Ignimbrit aus Idekulla
Ignimbrite aus
dem Oslograben
|
|