Cordierit (Mg,Fe)2 Al4Si5O18
Cordierit ist eng mit den eben besprochenen Silikaten (Sillimanit, Andalusit, Disthen) verwandt und kommt in ähnlichen oder gleichen Gesteinen vor. Auch Cordierit bildet sich metamorph aus sedimentärem Ausgangsmaterial und zwar kontaktmetamorph ebenso wie bei Regionalmetamorphosen. Deshalb kommt er ebenso in den sogenannten Knotenschiefern vor wie auch in Gneisen. Letztere sind im skandinavischen Geschiebe regelmäßig zu finden.
Cordierit ist mit einer
Härte von 7 nicht ritzbar. Er bricht muschelig uneben und hat nur eine
undeutliche oder gar keine erkennbare Spaltbarkeit. Cordierit neigt dazu,
andere Minerale zu umwachsen und ist häufig mit Biotit vergesellschaftet,
den es dann einschließt. Eingewachsener Biotit ist ein wichtiges Indiz für
die makroskopische Bestimmung.
Die auffälligste Eigenschaft von Cordierit aber ist sein Pleochroismus.
Damit bezeichnet man Mehrfarbigkeit, die allein von der Blickrichtung, also
der Orientierung des Kristallgitters abhängt. Um das zu sehen, benötigt man
einen einzelnen Cordierit, der durchscheinend bis klar sein sollte. Seine
Form spielt keine Rolle.
Je nach dem, wie man den Cordierit ins Licht hält, wechselt seine Farbe von
Dunkelblau über Hellblau zu Blassgelb.



Leider ist dieser
Farbwechsel nur bei isolierten Kristallen und nicht bei den im Gestein
eingebetteten Cordieriten zu beobachten. (Jedenfalls habe ich das noch nie
sehen können.)
Für die makroskopische Gesteinsbestimmung sind vor allem zwei Gesichtspunkte
relevant: Cordierit ist nur dann gut zu erkennen, wenn er frisch und
intensiv bläulich gefärbt ist. Einbettende Gesteine sind dann mit großer
Wahrscheinlichkeit Metasedimente. Allerdings kommt Cordierit auch in
magmatischen Gesteinen vor.
Ein schönes und gut zugängliches Geschiebe mit Cordierit liegt in der Findlingsausstellung der ehemaligen Kalkgrube in Lieth bei Elmshorn. Der Stein stammt aus dem nördlich gelegenen Lägerdorf. Das erste Bild zeigt das ganze Geschiebe, die beiden Ausschnittbilder schönen blauen Cordierit auf der Oberfläche dieses Gneises.
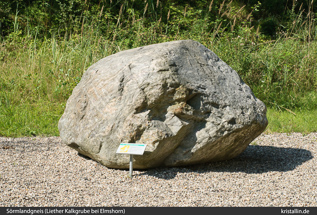 Dieses
Geschiebe ist ein Sörmlandgneis und ein typischer Vertreter skandinavischer
Paragneise. Um die Cordierite zu sehen, empfiehlt es sich, bei Sonnenschein
dort einzutreffen und Wasser zum Anfeuchten mitzubringen.
Dieses
Geschiebe ist ein Sörmlandgneis und ein typischer Vertreter skandinavischer
Paragneise. Um die Cordierite zu sehen, empfiehlt es sich, bei Sonnenschein
dort einzutreffen und Wasser zum Anfeuchten mitzubringen.
Einige Cordierite sind
mehrere Zentimeter groß und haben unscharfe Ränder. Andere sind kleiner und
scharf begrenzt.

Oben ist der Cordierit das blaue Mineral in der Bildmitte.
Unten siehe Pfeile.

(Vergrößerung ohne Beschriftung)
Die beiden Bildausschnitte befinden sich auf der Süd- und Südostseite des
Steins in der oberen Hälfte und sind für Erwachsene stehend zu finden. (Die
Koordinaten des Findlings sind: N 53.72145 E 9.67792. Der Stein liegt
hangabwärts am unteren Ende.)
So schöne blaue Cordierite sind wirklich nicht häufig. Oft ist das Mineral
nur blassgrau oder blaugrau und kann wegen seines muscheligen Bruchs mit
Quarz verwechselt werden. Da Cordierit dazu neigt, andere Minerale zu
umwachsen und oft zusammen mit Biotit vorkommt, sollten blaugraue oder graue
Minerale mit vielen Biotiteinschlüssen genauer beachtet werden. (Quarz
schließt normalerweise keine Biotitflocken ein.)
Beim Andalusit im vorigen Abschnitt hatte ich dieses Handstück hier links
bereits vorgestellt. Wenn man sich nun das graue Mineral unter- und oberhalb
des Andalusits ansieht, dann ist auch dies ein Kandidat für Cordierit.

Die vielen eingewachsenen schwarzen Biotitflocken sprechen sehr dafür und
ebenso die Tatsache, dass dies ein Metasediment ist. Hat man keine
Möglichkeit zu einer Laboruntersuchung, so kann man zumindest Cordierit als
Arbeitshypothese ins Auge fassen.
Aber Vorsicht! Nicht jedes
blaugraue Mineral in einem Paragneis ist auch gleich ein Cordierit. Zur
Warnung hier noch ein Gneis aus dem Südwesten Finnlands. (Für die Gegend
dort verzeichnet die geologische Karte an mehreren Stellen Cordieritgneise.)
Das unscharf begrenzte, bläuliche Mineral in der Mitte und im oberen Teil
fiel mir schon im Steinbruch auf, denn es ist im Sonnenlicht intensiv
blaugrau. Ich hoffte schon, schönen Cordierit gefunden zu haben.

Beim genaueren Hinsehen zeigte sich aber, dass das graublaue Mineral eine
gute Spaltbarkeit hat und danach fand ich auch noch polysynthetische
Verzwillingungen. Das hier ist Plagioklas.
Mit etwas Glück kann man
auch im Västervik-Fleckengestein frischen, blauen Cordierit finden. Im
folgenden geschnittenen Exemplar steckt in einigen der schwarzen Flecke auch
frischer Cordierit. Vor allem oben links und rechts unterhalb der Bildmitte.

Die schwarzen Flecke in den Västervik-Fleckengesteinen bestehen allesamt aus
metamorph gesprossten Cordieriten, sind aber wegen der massiven Einlagerung
von Biotit (+ eventuelle Alteration) ohne Hilfsmittel kaum als solche
erkennbar.
Frischer, bläulicher Cordierit, so wie in diesem Handstück aus Börgö, ist
bei Västervik-Gesteinen eine Ausnahme.
Auch in kontaktmetamorph
überprägten Sedimenten kommen Cordierite vor, die makroskopisch schwarz
aussehen und sich durch eine getreidekornähnliche Form auszeichnen. Solche
Gesteine werden deshalb auch als Fruchtschiefer oder Knotenschiefer
bezeichnet.

Fruchtschiefer von Theuma im Vogtland. Blick auf die Schieferungsebene.
°°°
Zur Herkunft der Proben:
Ein Teil der gezeigten Handstücke stammt aus Sammlungen Dritter. Sollten die
Angaben zur Herkunft von Proben unvollständig sein, dann ist das keine
Absicht.
Bitte schreiben Sie mir, damit ich Fehlendes ergänzen kann.
Verwendete Literatur:
Barth,
Correns, Eskola: Die Entstehung der Gesteine
Verlag Springer, Berlin 1939
Drüppel, K.: Von der Mantelschmelze zum Namibia Blue: Die komplexe Entstehungsgeschichte eines außergewöhnlichen Natursteinvorkommens Mitt.Österr.Miner.Ges. 151 (2005)
Jubelt,
R. Mineralbestimmungsbuch,
VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1970
Okrusch,
M.;
Matthes,
S.:
Mineralogie
Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und
Lagerstättenkunde
8., vollständig überarbeitete, erweiterte und aktualisierte Auflage
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
Seim,
R.
Minerale
1. Auflage Neumann Verlag, Radebeul 1970
Vinx,
R.
Gesteinsbestimmung im Gelände
3. Aufl., Heidelberg, Verlag Spektrum, 2011
Druckfassung (pdf)
Bilder benutzen