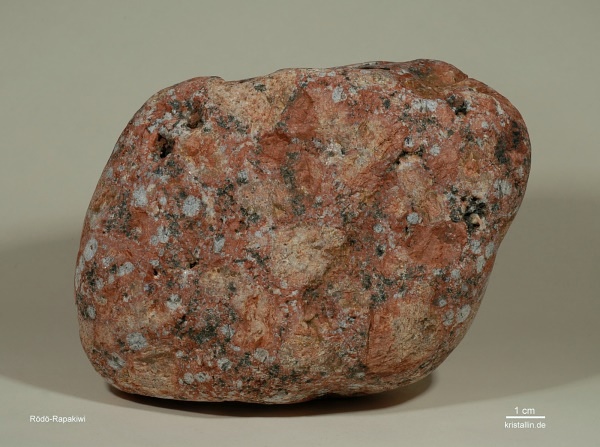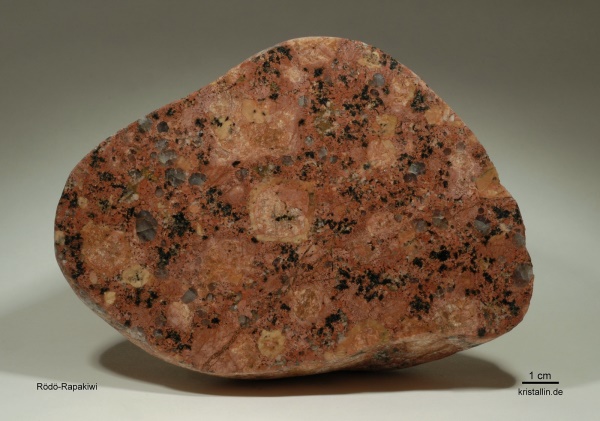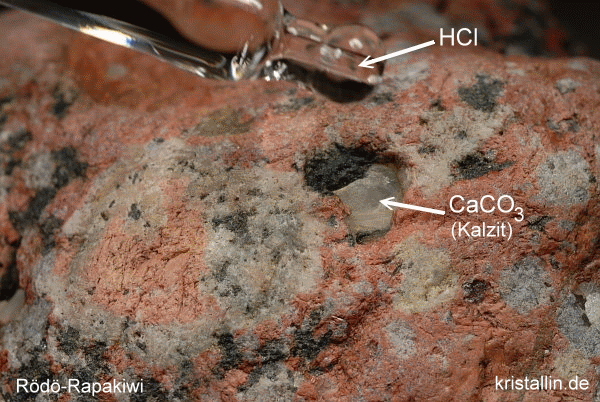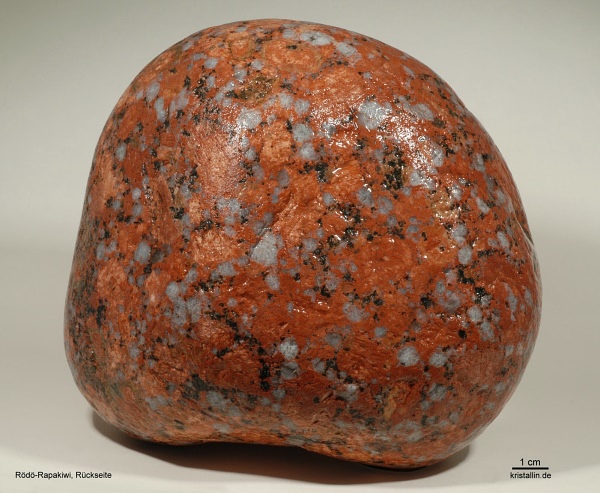kristallin.de >
Rapakiwis >
Rödö-Rapakiwis:
Seite 1 /
Seite 2 / Seite 3 /
Seite 4 /
Seite 5
Dies ist Druckansicht für die Wiborgite - auf drei Seiten:.
Auf einer Seite lesen
Zur
Normalansicht
Beschreibung der Gefügetypen auf Rödö:
1. Wiborgite
Wiborgitgefüge findet man auf Rödö in den unterschiedlichsten Varianten. Für
deren Gliederung habe ich die Färbung der Ovoide und der Grundmasse als
Kriterium gewählt, was eine Einteilung in drei große Gruppen ermöglicht.
Diese sind:
Wiborgite mit
rötlicher Grundmasse und hellen Ovoiden,
ziegelrote Wiborgite und
orangefarbene Wiborgite.
1.1. Wiborgite mit rötlicher Grundmasse und
hellen Ovoiden:
Nach meinen Beobachtungen ist dieser Typ auf Rödö am stärksten
verbreitet. Der Alkalifeldspat der Grundmasse ist hell rötlich, rötlichbraun
oder ziegelrot, während die Ovoide gelblichbraun, gelblich oder
fleischfarben sind und sich heller
von der umgebenden Grundmasse abheben.
Der Plagioklas, teils als Saum, teils idiomorph in der Grundmasse, ist in
diesen Gefügen sehr oft gelblich, gelegentlich auch braunrot. Diese
Wiborgite sehen insgesamt rötlichorange bis kräftig hellrot aus. Beispiele
für diese charakteristischen Gefüge folgen hier, alle stammen direkt von
Rödö:

Oben: Haupttyp des Rödö-Wiborgits mit hellen Ovoiden in roter Grundmasse. Loser
Stein vom Westufer
der Insel Rödö, angefeuchtet.
Es gibt in ganz Fennoskandia keinen weiteren Wiborgit, der eine so intensive
hellrote Gesamtfarbe aufweist. Das zweite prägende Kennzeichen sind die
großen, gerundeten und hellen Quarze, die Durchmesser bis 5 mm erreichen.
Die folgenden Nahaufnahmen zeigen das typische Gefüge dieser Rapakiwis.

Hellrötliche Grundmasse (Kalifeldspat), darin große, hellere Ovoide
(ebenfalls Alkalifeldspat), umgeben von einem oft gelblichem Saum aus
Plagioklas. Oft ist der Plagioklassaum kräftig ausgebildet, also mehrere
Millimeter dick.

Beachten Sie die runden Quarze im Bild oberhalb. Sie sind in dieser
Form ein wichtiges Kennzeichen für Rödö, denn hier sind diese Quarze (erste Generation) nicht so tief korrodiert wie zum Beispiel auf Aland
(Åland). Das trifft zwar nicht auf jedes einzelne Quarzkorn zu, aber doch
auf einen großen Teil. Erkennbar ist das an den weniger stark
gefurchten und eher glatten Rändern der großen Quarze.
Hier noch einmal, sozusagen zur Wiederholung, die wichtigsten Bestandteile eines Wiborgits.
(Die beschrifteten Elemente sind typisch für
alle Wiborgite, egal, woher sie stammen.)

Im Bild ist auch eine dritte Quarzgeneration enthalten. So etwas findet
man hin und wieder, dies ist kein für Rödö spezifisches oder sonstwie
besonderes Merkmal. Unten das unbeschriftete Bild.

Eine weitere Nahaufnahme dieser für alle Wiborgite wichtigen Komponenten
finden Sie hier weiter unten.
Um diese Einzelheiten zu erkennen, benötigen
Sie immer eine 10fach vergrößernde Lupe, denn ohne diese können Sie
die kleinen Quarze in der Grundmasse nicht erkennen - und ohne diese können Sie nicht mal Rapakiwis als solche
sicher bestimmen.
Zur Bestimmung ist es zweckmäßig, den Stein naß zu machen, denn das erleichtert die
Beobachtung der feinen Details erheblich. Der gleiche Stein sieht trocken so
aus:
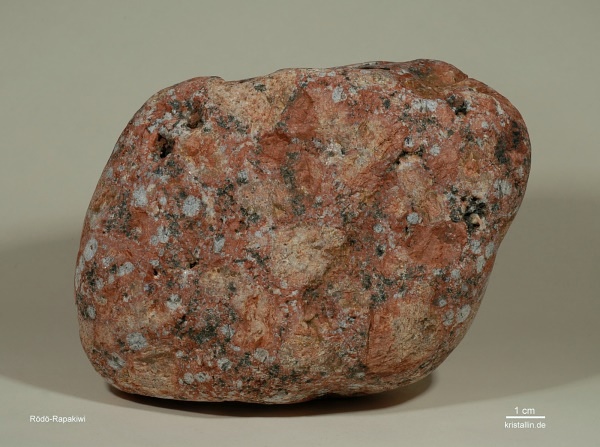
Die auffällige, hellrötliche Farbe ist noch deutlich erkennbar, ebenso der
hohe Quarzanteil, also die weißen, runden Flecken. Beachten Sie die Löcher oben links
und rechts. Dort war ursprünglich Kalzit, der inzwischen ausgewittert ist.
Siehe dazu auch die
Anmerkungen auf Seite 2.
Eine etwas blassere Variante des gleichen Typs sieht so aus:


Mehrfach habe ich
Formen mit sehr blassen Ovoiden gefunden. Dazu zwei Beispiele, die beide
ebenfalls von der Westseite Rödös stammen:

Bei dieser Ausbildung ist die Farbe der Grundmasse noch kräftig rot, während
die Ovoide schon deutlich aufgehellt sind.

Es geht aber noch blasser. Beim nächsten Beispiel unten ist auch die Grundmasse
aufgehellt.
Dieser blasse Wiborgit unterscheidet sich farblich zwar sehr vom Haupttyp
(oben), zeigt aber noch genügend charakteristische
Eigenschaften, um als Gestein von Rödö sicher erkannt zu werden. Das sind
vor allem die großen Ovoide, die kleinen Quarze in der Grundmasse sowie die
vielen großen, hellen, gerundeten Quarze. So helle Gefüge wie hier unterhalb
kommen im Anstehenden aber nur vereinzelt vor.


Unten: immer noch der gleiche Stein, anderer Ausschnitt mit mehr Quarz (Qz1)

Das nächste Beispiel zeigt einen typischen Wiborgit von Rödö mit einer
blaßbraunen Färbung, geschnitten und poliert.
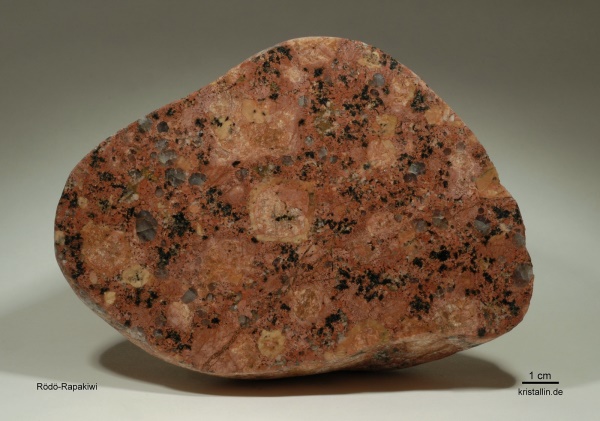
In den folgenden beiden Vergrößerungen sehen Sie noch einmal die für
Wiborgite wesentlichen Einzelheiten.
Das sind neben den beiden Generationen von Kalifeldspat (Einsprenglinge +
Grundmasse) die beiden Quarzgenerationen, wobei besonders die kleinen Quarze
(Qz2) wichtig sind. Sie bilden in der Grundmasse graphische
Verwachsungen mit dem Alkalifeldspat. Ohne dieser kleine Quarzgeneration ist
das Gestein kein Wiborgit.

Von diesem Bild gibt es eine
besonders große Variante (3000 x 2000 Pixel).
Wenn Ovoide keinen Plagioklassaum
haben, dann sind sie oft von einem Kranz aus
radialstrahlig gewachsenen winzigen Quarzen umgeben. Unten sehen
Sie dies am linken großen Feldspat.

Der nächste Rödö-Rapakiwi ist bunter als die bisherigen. Er fällt durch
einen ziemlich großen Ovoid auf (vorn links), der einen undeutlichen Saum aus
hellgraugelblichem Plagioklas hat. Außerdem ist ein weißes Mineral
vorhanden. Das ist aber kein
Kalzit, sondern ein Feldspat.

Um zu entscheiden, ob es sich um Kalzit handelt, hilft schon
eine einfache Ritzprobe. Kalzit ist weich und leicht zu ritzen, Feldspäte leisten
deutlich mehr Widerstand.

Wenn Sie kein geeignetes Werkzeug für eine Ritzprobe zur Hand haben oder die fraglichen
Minerale sehr klein sind, hilft
10-prozentige Salzsäure.
Sie sollte ohnehin zur Ausrüstung im Gelände gehören.
Wenn Sie Salzsäure auf Kalzit tropfen, schäumt dieser. In der folgenden
Animation ist das zu sehen.

Klicken
Sie auf eines der beiden Bilder, um eine Animation zu starten. Wenn Sie
können, nehmen Sie das größere Bild unten (9 MB), sonst, bei einer langsamen Verbindung,
die kleine Variante hier links (2 MB).
Sie sehen, daß nur das kleine Kalzitstück (CaCO3) in der Vertiefung reagiert, der Rest des Steins
bleibt von der Salzsäure völlig unbeeindruckt. Rechts oben bleibt der
Salzsäuretropfen liegen, denn Salzsäure greift weder Quarz noch Feldspäte
an.
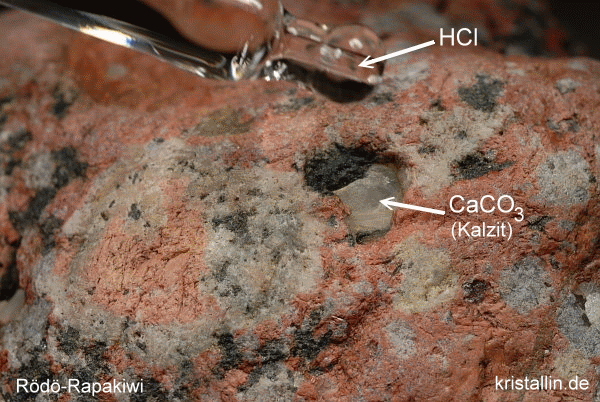
Gefügewechsel:
In jedem Granitpluton findet man eine Vielzahl unterschiedlichster Gefüge,
Rapakiwis machen da keine Ausnahme. Der Übergang von einem zum anderen
Gefüge vollzieht sich manchmal ganz allmählich, manchmal abrupt auf wenigen
Zentimetern. Mit etwas Glück passen sogar zwei unterschiedliche Gefüge
auf einen einzigen Stein. Dazu zwei Beispiele von Rödö:

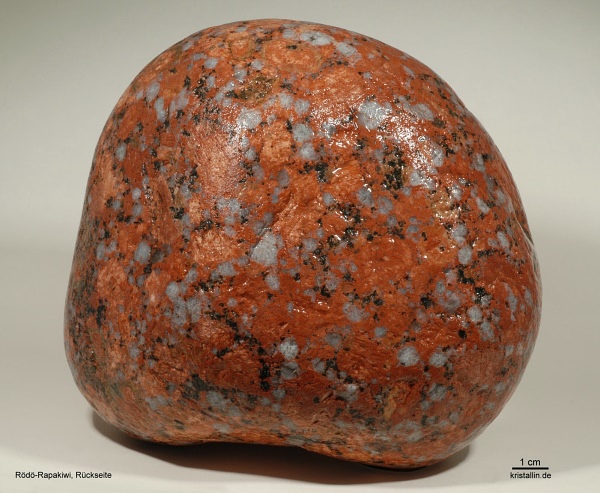

Beim Nächsten ist der Wechsel noch eindrucksvoller.
Zuerst die Vorderseite:

von hinten sieht das gleiche Stück aber so aus:

Zum Schluß noch Nahaufnahmen vom Stein oberhalb.
Hier sind alle Kennzeichen versammelt, die einen der Haupttypen von Rödö
auszeichnen:
Große Kalifeldspäte, teilweise von gelblichgrauem Plagioklas
gesäumt, große, helle Quarze, in der Grundmasse
Alkalifeldspat in graphischer Verwachsung mit Quarz, wobei die kleinen
Quarze verschiedene Umrisse zeigen. Probe vom Südwestufer Rödös.

Unterhalb: Heller Plagioklas, teils als Saum, teilweise eigenständig,
hellrötlicher Alkalifeldspat und Quarze in zwei Generationen: Groß und rund
die erste, klein und vielgestaltig die zweite.

Besonders hübsch sind die Rosetten aus winzigen Quarzen, die sich um Kalifeldspäte gebildet haben:

Weiter mit den ziegelroten Wiborgitgefügen
>>
<<
zurück zur den gemeinsamen Merkmalen der Rödö-Rapakiwis
die Wiborgitbeschreibungen auf einer
Seite lesen
nach
oben