Der folgende Text stammt aus dem
Jahre 1924.
Zu dieser Zeit waren viele Erkenntnisse, die uns heute
selbstverständlich sind,
noch recht frisch und ganz offensichtlich wurde damals noch um die
Bestimmung
und die Unterscheidung von Windkantern und Eiskantern gerungen.
Der Text wurde von mir als Textdatei neu formatiert.
Inhaltlich wurde nichts geändert, von der Numerierung der Fußnoten
abgesehen. Abbildung am Ende des Textes.
Der Text stammt aus dem Band 1 der "Zeitschrift für Geschiebeforschung".
Diese Zeitschrift wurde von Dr. Hucke herausgegeben und erschien 19 Jahre
lang.
Sie wird von der "Gesellschaft für Geschiebekunde" weitergeführt und heißt
heute: "Geschiebekunde aktuell".
Die Terminologie der sogenannten Kantengeschiebe hat sich allmählich soweit
geklärt, daß man die durch Windschliff facettierten Geschiebe als Windkanter
bezeichnet und von den durch das Eis in der Grundmoräne angeschliffenen
Facettengeschieben scharf sondert. Das beide verbindende Moment, daß sie
"Geschiebe" waren, hatte sich der Klärung dieser Scheidung entgegengestellt
und sollte aus der Bezeichnung dieser Gebilde ganz ausscheiden. Windkanter,
deren Name meines Wissens zuerst von VORWERG 1) gebraucht wurde, sind zwar
bei uns in Norddeutschland wie in allen Glazialgebieten meistens Geschiebe,
können sich aber naturgemäß überall bilden, wo der Wind frei über eine
steinbestreute Fläche fegt, und die dort von ihnen bearbeiteten Steine
brauchen keineswegs Geschiebe zu sein.
PFANNKUCH hat die ältere Ansicht von MICKWITZ, daß die Schlifflächen nach
den Hauptwindrichtungen orientiert seien, durch die Angabe ersetzt, daß sich
die Flächenbildung der ursprünglichen Form des Steines anpaßt bzw. durch
diese bestimmt wird. Mir scheint, daß dieser Faktor von MICKWITZ 2) nicht
genügend berücksichtigt wurde, daß er aber nicht allein den Ausschlag gibt.
Es wird das ganz von der Windstärke und den lokalen Bedingungen seiner
Arbeitsleistung abhängen. Das bestätigen auch die Beobachtungen von JOH.
WALTHER 3) in der libyschen Wüste, wo bei einseitiger Windwirkung nur
einseitiger Abschliff zustande kommt. Im Anfang wird die Form des Steines
die Schliffläche bestimmen, später aber die Windrichtung zum entscheidenden
Faktor werden.
Die Facettengeschiebe im engeren Sinne sind unter dem Eis entstanden, aber
auch sie brauchen nicht unbedingt Geschiebe zu sein. Zwei Möglichkeiten sind
dabei gegeben. Entweder werden die Steine mit dem Eis vorgeschoben oder sie
lagern als Steinpflaster auf dem Boden, den das Eis überschritt. Im
letzteren Falle können sie von anstehenden Gesteinsmassen abgelöst sein, und
durch das Eis wohl eine Schleifung und Kantung, aber keine Ortsbewegung
erfahren haben. Dann wären sie also keine "Geschiebe". Ich schlage daher
vor, die "Facettengeschiebe" auch im engeren Sinne durch "Eiskanter" zu
ersetzen. Dieser Name ist ganz unverfänglich und hebt das einigende
Kennzeichen aller dieser "Kanter", eben die Kantenbildung, klar hervor.
Eiskanter wurden meines Wissens zuerst aus den permischen Glazialschichten
Indiens beschrieben und in unserem baltischen Glazialgebiet erst später
aufgefunden, so daß man zunächst glaubte, daß sie unseren Gebieten ganz
fehlten. Die bisher gefundenen Stücke zeigten die Kantung in der Regel nur
schwach ausgeprägt, so daß über die Art ihrer Bildung kein klares Urteil zu
gewinnen war. Der im folgenden beschriebene Eiskanter ist nun so
vortrefflich klar in seiner Formung und Erhaltung, daß er den Gang seiner
Entstehung als Eiskanter in allen Einzelheiten erkennen läßt.
Das Stück wurde auf dem ca. 100 m hohen Höhenzuge bei Tentzerow südlich
Demmin von Herrn FREIHERR VON SECKENDORF im Geschiebemergel nahe der
Oberfläche gefunden und mir freundlichst für die pommersche Landessammlung
überlassen. Es ist ein gelblich-grauer , feinkörniger, dichter Kalkstein,
der an Feinheit fast dem Solnhofener Plattenkalk gleichkommt. Er enthält nur
wenig Spuren verkieselter Fossilreste, von denen einige an Gyclocrinus
erinnernde Kalkalgenreste undeutlich erkennbar sind. Es dürfte sich um einen
Lyckholmer Kalk aus dem oberen Untersilur handeln, wie er bei Oddalem in
Esthland gefunden wird. Auf einer rauhen Seite und einem Teil der einen
Schliffläche haftete ein nachträglicher dünner Überzug von Kalksinter, den
ich von der angeschliffenen Fläche wieder vorsichtig entfernt habe, um deren
Schlifflinien klarer erkennen zu lassen. Das Stück ist 17 cm lang, 8 bzw.
9,5 cm dick und an beiden Enden kegelförmig verjüngt. Die genauere Form des
Geschiebes geht aus beistellenden Abbildungen und den Photographien Tafel II
hervor. Jede seiner vier Hauptflächen ist nacheinander angeschliffen worden,
und es läßt sich in allen Einzelheiten klarstellen, welche Bewegungen der
Stein dabei gemacht hat.

In der breitesten, in Abb. l unteren Fläche I kreuzen sich zwei
Rillen-Systeme, von denen eines das andere abschleift (Taf. II Abb. 1).
Letzteres ist also das erste und die Änderung der Schliffrichtung kann nur
dadurch zustande gekommen sein, daß der Stein in der Ebene der Fläche I eine
horizontale Drehung um genau 45° erfahren hat. Die nun eingetretene
Schrammung hat besonders den linken Teil der Fläche l in Tafel II Abb. l
angeschliffen, aber vereinzelte Rillen kreuzen auch den rechten Teil der
Fläche, allerdings etwas unregelmäßiger. Die eine dieser Rillen dürfte wohl
durch einen harten Punkt des festen Untergrundes oder durch ein dazwischen
geschobenes Kieselsteinchen verursacht worden sein.
Die neue Richtung der Fläche I setzt sich nun auf der Nachbarfläche II
gleichsinnig fort (Tafel II Abb. 2 oben). Der Stein muß also gekantet, aber
nicht horizontal gedreht worden sein. Eine solche horizontale Drehung erfuhr
er aber noch während er auf dieser Fläche geschoben wurde, denn ihr unterer
Teil in Tafel 11 Abb. 2 zeigt in neuen Schrammen eine Drehung um ca. 70°.
Dabei fand eine leichte Kantung um etwa 15° statt; dadurch ist der obere
Teil der Fläche durch diese neue Schrammung unbehelligt geblieben.

Das letzte Schrammen-System setzte sich nun in gleicher Richtung fort als
der Stein um ca. 95° in die Fläche III gekantet wurde (Tafel II Abb. 3),
ebenso als dann eine kleine Kantung um etwa 10° erfolgte und schließlich
durch eine letzte Kantung die Fläche IV (Tafel II Abb. 3) angeschliffen
wurde.
Damit hat die Abschleifung und die Kantenbildung ihr Ende erreicht, der
Stein wurde wahrscheinlich mit der Spitze dieser keilförmigen Fläche
angehoben und dadurch aus der Reibungszone vom Boden des Eises entfernt.
Dieser Zufall hat ihn vor weiteren Veränderungen bewahrt und dadurch seine
früheren Schlifflächen in allen Einzelheiten intakt erhalten.
Von Besonderheiten ist noch zu erwähnen, daß der Stein bei jeder Kantung auf
der Kante Absplisse erfuhr, die z. T. durch den neuen Anschliff wieder
abgeschliffen wurden.
Es erscheint ausgeschlossen, daß dieser Stein in einem festen Steinpflaster
im untersten Teil des Eises durch dessen Grundmoräne angeschliffen wurde. In
diesem Falle bliebe nicht nur seine Kantung, sondern auch der Umstand
unverständlich, daß die bereits angeschliffenen Flächen fast gar keine
Kritzen durch andere Steine aufweisen, Der Stein mußte also im Eise
eingeschmolzen sein.
Der Anschliff kann auch nicht auf anderen Geschieben erfolgt sein, denn dann
könnte er unmöglich so gleichmäßig sein, da sich ein anderes Geschiebe, auch
wenn es noch so groß gewesen wäre, doch auch in der Grundmoräne bewegt haben
würde. Der Anschliff muß also auf festem Untergründe erfolgt sein. Da dieses
Geschiebe in oberdiluvialem Geschiebe-Mergel lag, so könnten als Untergrund
kaum anstehende Gesteine in Pommern in Betracht
Auch wegen der Schärfe des Anschliffes auf dem harten Gestein kann wohl nur
ein festes gleichartiges quarzhaltiges Gestein, also namentlich ein
Massengestein oder ein harter Sandstein als Schleifstein fungiert haben.
Bemerkenswert ist noch, daß dieses Geschiebe nachher auf dem langen Wege bis
zum südlichen Pommern keine nennenswerte Kritzung mehr erfuhr. Es scheint
also, daß die scharfe Anschleifung dieser Kantengeschiebe nur auf dem festen
Untergrund baltischer Gebiete erfolgt sein kann.
Daß die mehrfache Kantung durch Unebenheiten des Untergrundes bewirkt war,
ist wenig wahrscheinlich, da der Stein sonst nicht auf vier Flächen die
gleiche Richtung hätte bewahren können. Die Ursache der Kantung kann also
nur darin gesucht werden, daß die Eisumfassung einem gewissen Druck nachgab,
und der Stein dadurch eine entsprechende Bewegungsfreiheit erhielt. Daß
Erwärmung des Steines durch die Reibung dabei in Rechnung gestellt werden
könnte, scheint mir nur dann möglich, wenn die Bewegung ziemlich schnell
erfolgt wäre. Da aber in Grönland die Bewegung des Eises selbst am
Außenrande nur etwa 24 m pro Tag erreicht, scheint mir eine Erhöhung der
Temperatur des Steines wenig wahrscheinlich. Dagegen möchte ich glauben, daß
der Stein auf seine schiebende Rückwand einen solchen Gegendruck ausübte,
daß diese durch den Druck plastisch wurde. Ein stärkerer Stoß auf die
Vorderkante des Steines konnte dadurch entstehen, daß sie auf irgend ein
Hindernis stieß, oder dadurch, daß sich vor dem Stein Reibungschutt
anhäufte, das Eis dort entfernte und so die Vorderkante exponierte. Durch
alle solche Möglichkeiten war der Anreiz zu einer Kantung gegeben, und wenn
dann eben das Eis hinter dem Stein in einen plastischen Zustand geraten war,
mußte seine Kantung erfolgen.
Das merkwürdigste ist, daß der Stein nach dem letzten Anschleifen der Fläche
IV nicht weiter gekantet wurde und dadurch alle seine Schlifflächen intakt
erhielt. Das konnte dadurch verursacht worden sein, daß zuletzt die ziemlich
scharfe Spitze des Steines (Tafel II Abb. 3 unten) durch vorgelagerten
Detritus angehoben wurde und daß damit der ganze Stein in ein höheres Niveau
des Eises gehoben und der Schleifzone entrückt wurde. Möglich wäre ja auch,
daß er nach Anschleifung von Fläche IV den festen Untergrund überschritten
hatte, aber ein derart zufälliges Zusammentreffen ist wenig wahrscheinlich.
1) O. Vorweg, Zur Kantengeschiebefrage. Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.
Jahrg. 1907, S. 105
2) A. Mickwitz, Die Dreikanter, ein Produkt des Flugsandschliffes.
3) J. Walther, Über die Bildung von Windkantern in der Libyschen Wüste.
Zeitschr. d. dtsch. geol. Ges. 63, 410-417, 1 Fig., 1911.
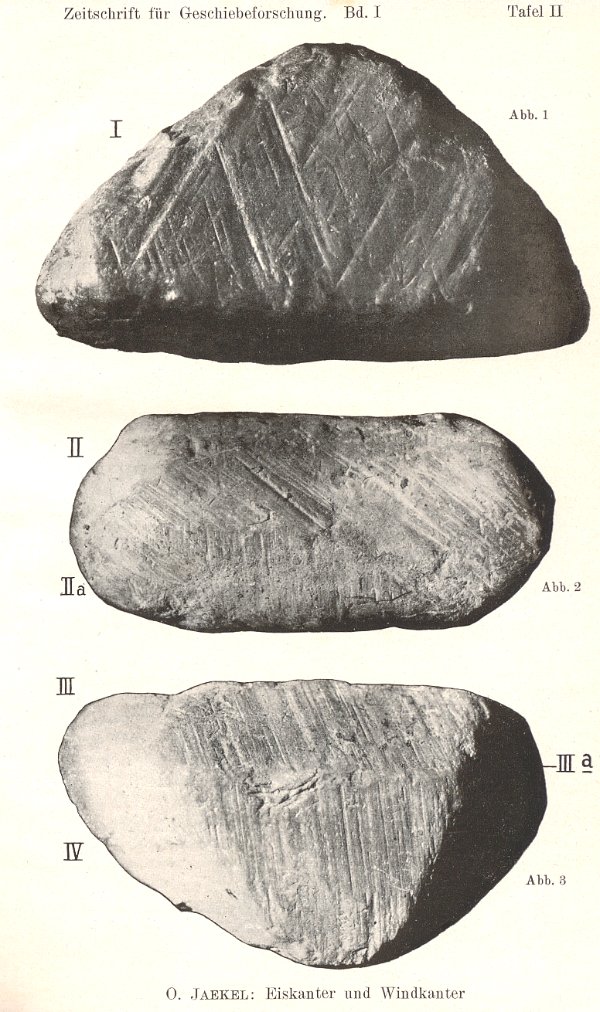
|
|